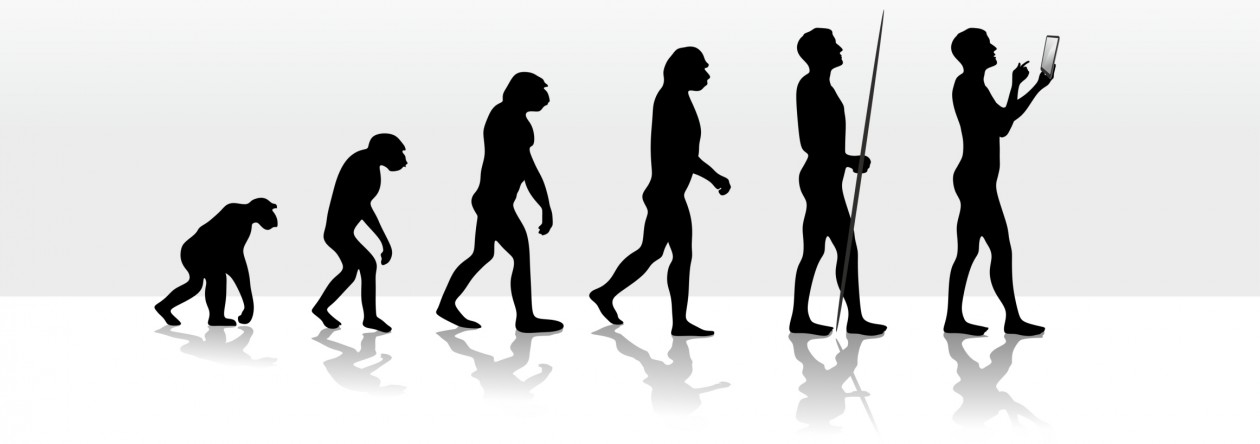Zum 700. Geburtstag: Manifest wider die Bundesabschaffer und für ein lateinisches Landesbewusstsein. Von Niklaus Meienberg
«Wollen wir oder wollen wir nicht
ein schweizerischer Staat bleiben,
der dem Auslande gegenüber
eine politische Einheit darstellt?
Wenn nein (…), dann lasse man’s
meinetwegen laufen, wie es geht
und schlottert und lottert.
Carl Spitteler, 1914
«Unser Schweizer Standpunkt»
Ein Gespenst geht um in der Schweiz, termingerecht zum angeblichen 700. Geburtstag, der uns von Regierung und Parlament eingebrockt worden ist, ohne dass man vorgängig über die Bedeutung dieser Jahreszahl nachgedacht hätte: das Gespenst der Auflösung. Es geht um im Kopf des SBG-Direktors Ernst Mühlemann, welcher der Zeitschrift L’Hebdo erklärt, die Abschaffung der Schweiz liege im Bereich des Möglichen und die Nationalstaaten seien generell auf dem Aussterbeetat. Es geistert in der Vorstellungswelt des wackeren Fernsehdirektors Schellenberg herum, welcher sich sehr gut vorstellen kann, dass sich die Welschschweiz Frankreich anschliesst und das Tessin Italien (kulturell oder territorial?). (Da bliebe doch wohl für die Deutschschweiz nur noch der Anschluss an Grossdeutschland?) Und der Philosoph Hans Saner, im allgemeinen kein Spassmacher, hat kürzlich am Radio erklärt: Es ist zu Ende mit diesem Land. Was soll es noch! In pseudolinken Konventikeln wird fleissig der Slogan 700 Jahre sind genug herumtrompetet, und der schweizerische Spiegel-Korrespondent Bürgi dekretiert nassforsch, unserem Staat sei die Raison d’être abhanden gekommen, und eine neue ist nicht in Sicht. Da fehlt nur noch Gerd Bucerius, Herausgeber der Zeit, welcher die Schweiz als Staatssplitter bezeichnete.
Sind, so muss man sich fragen, noch alle Tassen im Schrank? Dass Ernst Mühlemann, der sich ebensogut bei der Deutschen Bank wie bei der SBG als Prokurist verdingen kann, die Abschaffung der Schweiz akzeptiert, kann die Kenner des heimatlosen Kapitals nicht verblüffen; und der aufgeblähte Bucerius spricht halt vom hohen deutschen Ross herunter. Aber unsere Linken und gar die Denker?
Ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Intellektuellen hat bekanntlich deklariert, dass er nichts zu diesem Jubiläum beitragen wolle, weil man für einen Staat, der die Fichen und Dossiers der Bespitzelung nicht offenlege, keinen Finger rühren möge («Kulturboykott»). Manche finden überdies, das Geburtsdatum 1291 sei ein Jux und die Eidgenossenschaft keineswegs samenhaft in den drei Urkantonen angelegt gewesen (dem stimmt sogar der konservative Historiker Peyer in der NZZ zu) und die halbfeudale Agrargesellschaft des 13. und 14. Jahrhunderts bedeute uns heute nichts mehr, wohingegen man den Import der bürgerlichen Freiheiten durch die Armeen der Französischen Republik (1798), ohne welche wir den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit nicht gefunden hätten, sowie die Bekräftigung dieser Freiheiten in der Verfassung von 1848 mit einiger Berechtigung hätte feiern können (1998).
Von einer Auflösung der Schweiz war dabei nicht die Rede, auch nicht vom doofen Slogan 700 Jahre sind genug, weil ja, nach Auffassung gerade der sogenannten Kulturboykottanten, die Schweiz in ihrer modernen Form eben nicht seit 700 Jahren besteht. Man wird sich deshalb, gerade als einer, der aus Sympathie für die guten Traditionen der Demokratie den 1991er Rummel nicht mitmachen will, von den Schnörrenwagnern und Plaudertäschchen und Abschaffungsaposteln distanzieren müssen, denn:
Wir wollen nicht keine Schweiz, sondern eine andere als die gegenwärtig grassierende.
Kanalratte und Blähnüsterich
Ein hübscher Gedanke, dass die Deutschschweiz in Deutschland aufgehen könnte: Kohl als Wahlredner in Zürich, da müsste man grad Attentäter werden. Zu diesem Staat gehören, dessen Bürger nicht mal darüber abstimmen können, ob sie mit einem andern Staat (DDR) fusionieren wollen; und ein Plebiszit über die Armee gibt’s dort auch nicht. Aber bitte, dieser Wunsch hat Tradition, schon Gottfried Keller meinte, nur die deutsche Staatsform, damals monarchisch, hindere uns daran, in Deutschland aufzugehen, und unterdessen haben sie dort doch Demokratie. Aus der Welschschweiz könnte man dann etwa vier französische Départements machen und diese zur Region Burgund schlagen, mit Ausnahme des Juras; das Wallis, von Italien geschluckt (war schon zu Mussolinis Zeiten geplant) wie auch das Tessin und die italienischsprachigen Bündnertäler: Wäre dann exakt jene Aufteilung der territorialen Partikeln, die uns im faschistischen Europa geblüht hätte.
Keine Raison d’être, wie der seltsame Bürgi im Spiegel meint? Hoppla! Allen Regionen geht es besser, wenn sie nach Bern ausgerichtet sind und nicht nach Berlin, Rom oder Paris. Alle würden zu Randgebieten degradiert, auch im EG-Europa, wo die Nationalstaaten keineswegs über Nacht verdunsten (schon mal etwas von der Langlebigkeit des französischen Zentralismus gehört?). Und, bei allem Entsetzen über den gegenwärtigen Zustand der Schweiz: Wir wurden in den vergangenen hundert Jahren nicht von einer Kanalratte angeführt (1933–45) oder von einem pubertierenden Blähnüsterich, dem sogenannten Kaiser, und Koller ist weniger schlimm als Kohl und in unserem System wohl doch besser kontrollierbar (Small is beautiful). Im neuen, voraussichtlich von Grossdeutschland bzw. der Deutschen Bank dominierten Europa werden wir uns als Staat nur behaupten können, wenn die übermächtigen Deutschschweizer sich dem grossdeutschen Sog entziehen und sich endlich energisch der lateinischen Komponente im Lande zuwenden: so dass die Schweiz notfalls mit Frankreich, Italien und Spanien zusammen Front machen kann gegen den heraufziehenden teutonischen Wirtschaftsimperialismus. Das heisst: endlich Französisch lernen in der Deutschschweiz (und Italienisch)! Das Tessin benützen wir vornehmlich als Unterlage für unsere Ferienhäuser. Es gibt Zürcher, die noch nie in Fribourg waren, aber eine Loft in New York besitzen. Kaum ein Deutschschweizer Schriftsteller, der ein passables Französisch spräche: Für Interviews oder gar Debatten an Radio/TV romande reicht’s auf keinen Fall. Kaum ein Deutschschweizer Journalist, abgesehen von Marcel Schwander, der sich als Brückenbauer verstünde (die Welschen haben immerhin François Gross und Jacques Pilet). Der letzte Schrei aus Manhattan, Frankfurt, Berlin oder Hamburg gellt immer sofort nach Zürich; aber den Unterschied zwischen der waadtländischen, neuenburgischen, genferischen, fribourgischen und jurassischen Befindlichkeit kennt hier fast niemand. Der Weg zu den Romands führt allerdings über Paris, und weil Frankreich nicht mehr «in» ist (als Bildungserlebnis), leben wir an den Welschen vorbei. Auch da hat der vielgepriesene Gottfried Keller vorgespurt: kam nie über Murten hinaus, verabscheute Paris, ohne es zu kennen, malträtierte die französische Sprache und trieb sich ausschliesslich im deutschsprachigen Ausland herum. Ein schöner National-Dichter!
Larmoyanter Onkel Muschg
Reizvoll, wenn die Deutschschweizer Intellektuellen, anstatt in der Roten Fabrik larmoyant den Untergang der Schweiz, wobei sie immer nur die Deutschschweiz meinen, zu beschnorren (Onkel Muschg: «Ich bin froh um diese Ratlosigkeit»), eventuell Bücher schreiben würden, welche in der Welsch- wie in der Deutschschweiz zu heftigen Debatten führen und so die Landesteile miteinander verklammern könnten (Tertium comparationis).
Höchste Zeit, dass alle Studierenden mindestens zwei, besser noch vier Semester in der Welschschweiz absolvieren (die Welschen umgekehrt bei uns). Das kann man nicht erzwingen? O doch, ein offiziell polyglotter Staat muss das können: Den Schulzwang haben wir schliesslich auch akzeptiert. Warum immer an der langweiligen Zürcher Uni herumhängen? Das kostet allerdings Geld (mehr Studienplätze, Stipendien). Die patriotischen Milliardäre, Schmidheiny und Blocher u.a.m., werden es gern lockermachen.
Schön, wenn jede Berufslehre obligatorisch mindestens ein Welschlandjahr bedeuten würde (mit der Einrichtung der «filles au pair», die in welschen Haushalten ausgebeutet werden, ist kein Staat zu machen). Und jeder Journalist, der in der Deutschschweiz fest angestellt werden möchte, sollte einen längeren Stage bei einer welschen – oder bei einer französischen? – Zeitung absolviert haben müssen.
Bundespräsident vors Volk
Die Landesteile könnte man politisch miteinander verklammern, indem man, die Anregung von Nationalrat Bremi aufnehmend, der einen Bundespräsidenten mit erweiterten Kompetenzen installieren möchte, diesen Präsidenten gleich noch vom – horribile dictu! – Volk wählen liesse (vielleicht auf vier, keinesfalls auf sieben Jahre). So müsste denn ein Politiker mit seinem Programm und seiner Persönlichkeit die Kampagne im alemannischen und welschen Landesteil führen, überall gleichmässig bekannt und akzeptiert werden und debattieren, bevor er gewählt wird, auf deutsch und französisch; und dabei würden bestimmt die jetzt gebräuchlichen schwachen Figuren aus dem Rennen fallen: die Deutschschweizer schon wegen ihres miserablen Französisch.
Das allerdings bedingt eine Verfassungsänderung – ein schönes und seriöses Geschenk, vom Jubiläumsjahr inspiriert.
Erschienen am 10. Januar 1991
Niklaus Meienberg (1940–1993) schrieb im Mai 1968 von Paris aus für die Weltwoche und publizierte auch später immer wieder Texte in diesem Blatt.